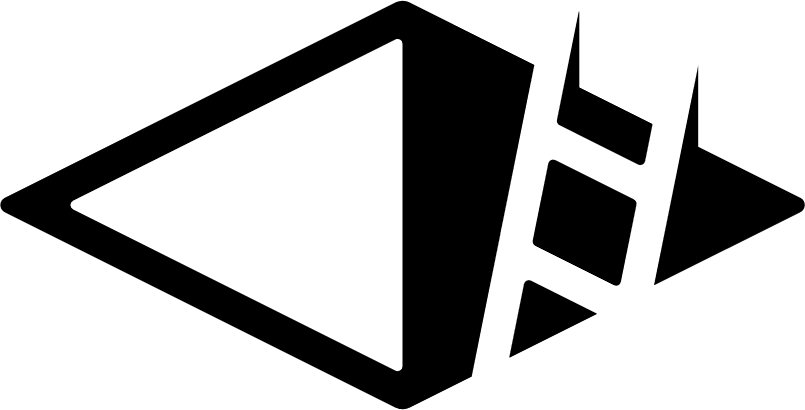Wenn du dich auf meiner Seite umgeschaut hast oder mich vielleicht sogar schon aus anderen Kontexten kennst, weißt du vermutlich, dass ich unter anderem Theaterpädagoge bin. Als Jugendlicher und junger Erwachsener habe ich selbst Theater gespielt, unter anderem im Jugendclub des Saarländischen Staatstheaters, und heute denke ich, dass diese für mich eine der wichtigsten und prägendsten Erfahrungen war, da ich dabei unheimlich viel über mich selbst gelernt und an Selbstvertrauen gewonnen habe. Heute nutze ich theaterpädagogische Methoden nicht nur für die Kunst, sondern auch für meine Arbeit als Coach und Trainer, weil ich davon überzeugt bin, dass sie ein riesiges Potential haben, um Menschen zu helfen sich weiterzuentwickeln. Im Folgenden möchte ich dir gerne erläutern, warum Persönlichkeitsentwicklung durch Theater meiner Meinung nach so gut funktioniert und einen Einblick geben, welche Methoden und Konzepte ich gerne nutze.
Ich liebe theaterpädagogische Arbeit; insbesondere Projekte mit Laien, in denen wir eigene Stücke entwickeln. Das sind die schönsten Erfahrungen. Denn über den künstlerischen Mehrwert und den Aspekt der ästhetischen Bildung hinaus passiert immer etwas ganz Besonderes, das für mich den Kern meiner Arbeit als Theaterpädagoge wie als Coach darstellt: Die Teilnehmenden kommen im Prozess mehr zu sich und wachsen über sich hinaus. Das habe ich bei jedem Projekt beobachtet. Bei manchen mehr, bei anderen weniger, aber es war immer präsent, dieses Gefühl von „sich entwickeln“. Ich glaube, das liegt nicht nur an mir und meiner Art, solche Projekte anzugehen, sondern vor allem daran, dass dieses Transformationspotential integraler Teil der Theaterarbeit ist.
Die ästhetische Auseinandersetzung mit sich, einer Rolle, Konflikten, Beziehungen und allem, was auf der Bühne verhandelt wird, wirkt wie ein Katalysator für das „Ich“. Drei Aspekte sind dabei besonders wichtig:
Wenn ich eine Rolle spiele, dann passiert etwas, das man in der Theaterpädagogik „Differenzerfahrung“ nennt. In der Rolle bin ich nicht „Ich“, sondern diese Figur, also quasi „Nicht-Ich“. D.h. ich handle im Rahmen ihrer (nicht meiner) Motivationen, Denkmuster, Überzeugungen, Nöte, Ängste, Wünsche, Bedürfnisse etc. All das sind Aspekte, ich mir beim Erarbeiten dieser Rolle bewusst machen muss. Auch nehme ich die Körperlichkeit der Figur an, ihre Haltung, ihre Bewegungsqualität, ihre typischen Gesten, Ticks usw.
Gleichzeitig bin ich aber in dem Augenblick, in dem ich die Rolle spiele, auch nicht „Nicht-Ich“, weil ich ja derjenige bin, der da agiert und die Rolle ausfüllt, also quasi ein „Nicht-Nicht-Ich“. In der Theaterpädagogik sagen wir auch ein „Ich¯“ (gesprochen „Ich Strich“). Durch das gleichzeitige Erleben von Ich und Ich¯ muss ich mich automatisch permanent fragen: Was von dem, das ich in der Rolle gerade tue, denke, fühle etc. gehört zu mir und was zur Rolle? Und das setzt unweigerlich, je nach Anleitung oder Rahmen bewusst oder unbewusst, eine Reflexion der eigenen Werte und Denkmuster in Gang: Würde ich so handeln wie die Figur? Bewerte ich die Situation so wie die Figur? Würde ich auch so entscheiden? Usw.
So findet notwendigerweise eine Auseinandersetzung mit den eigenen Werten, Denkmustern, Glaubenssätzen etc. statt. Ich grenze mich von der Rolle ab und lerne dabei gleichzeitig, wo eigentlich die Grenzen meiner eigenen Persönlichkeit liegen. Das ist quasi eine ästhetisierte Selbstreflexion über Bande. Die Rolle schützt mich dabei zusätzlich.
Der theatrale Rahmen, die Geschichte des Stücks, die Rolle, all diese Aspekte schützen mich bzw. mein Selbst davor, etwas „falsches“ oder „schlechtes“ zu tun, mich zu blamieren oder Beziehungen zu beschädigen. Was ich damit meine, ist Folgendes: Indem ich im Schutze einer Rolle und/oder im Rahmen einer Geschichte handle, kann ich verschiedene Verhaltensweisen, Denkmuster, Annahmen etc. ausprobieren, ohne dass mir im „echten Leben“ tatsächlich Konsequenzen drohen, wenn es schief geht. Es ist ja nur auf der Bühne passiert. Besonders wirkungsvoll ist das beim Improvisationstheater, wenn meine Rolle in dem Augenblick entsteht und ich durch die spontan improvisierten Reaktionen meiner Mitspielenden direktes Feedback zu meinem Verhalten bekomme.
Ich kann alle möglichen Situationen durchspielen, verschiedenste Strategien ausprobieren und im Anschluss mit meinen Mitspielenden darüber sprechen, was wie gewirkt oder funktioniert hat, und nach der Improrunde gehe ich raus und kann Gutes mitnehmen und Schlechtes dort lassen.
Darüber hinaus gilt, so wie ich es kennengelernt habe, in theaterpädagogischen Projekten auch immer die Randbedingung: Alles, was auf der Probe passiert, ist erst mal geschützt und bleibt dort, es sei denn, ihr wollt es nach außen tragen. Das soll vor allem Laien schützen, wenn sie zu tief in eine Rolle einsteigen oder emotional getriggert und dann wütend werden oder weinen müssen etc. Und das ist wunderbar. Darüber hinaus wirkt der Rahmen aber in der oben beschriebenen Weise noch weiter. Und das finde ich wahnsinnig wertvoll.
Wenn ich mich mit Rollen und ihrer Inszenierung auseinandersetze, stelle ich fest, dass neben den internalen Aspekten wie Motivation, Bedürfnissen, Ängsten etc. auch die äußeren Faktoren wichtig sind. Dazu gehören insbesondere soziale Kontexte und damit verknüpfte soziale Rollen, in denen sich die Figur bewegt, wie z.B. Kollege, Freundin, Ehemann, Mutter, Bruder, Tochter usw. All diese Rollen gehen mit bestimmten Erwartungen und Aufgaben sowie mit einem bestimmten Status einher.
Eine wichtige Entscheidung in der Inszenierung ist, ob und wie die Figur diese Erwartungen und Aufgaben erfüllt und ob sie den Status der sozialen Rolle trifft oder nicht. D.h. zum Beispiel, ob der Graf sich verhält wie ein Graf, ob er sich aufführt wie der König (also höheren Status spielt) oder ob er sich herumscheuchen lässt wie ein Diener (tieferer Status). Wie die Figur ihre sozialen Rollen ausfüllt, hängt also davon ab, wie ich sie inszeniere. Von da ist es nur ein kleiner Schritt zu begreifen, dass auch meine sozialen Rollen im echten Leben bis zu einem gewissen Grad eine Art Inszenierung sind.
Ich inszeniere mich selbst vor dem Hintergrund dessen, was ich über mich denke. Wenn ich erkenne, dass ich in dieser Inszenierung selbst aktiv die Regie übernehmen kann, dann gewinne ich Handlungsspielraum. Erfahre ich meine sozialen Rollen als gestaltbar, habe ich in Situationen, in denen ich bisher z.B. so etwas dachte wie: „Das ist so, weil ich halt so bin und weil das immer so ist.“, jetzt die Chance, mich neu zu inszenieren. Das tue ich, indem ich meine Haltung, Denkmuster, Glaubenssätze usw. hinterfrage, bearbeite und entsprechend neu oder anders handle. Inszenierung soll hier nicht bedeuten „so zu tun als ob“ oder „faken“. Es heißt vielmehr mein Selbst zu stärken, zu mir passende neue Wege und Strategien zu finden und für mich einzustehen. Das klingt nicht zufällig nach Coaching!
Ich hoffe, es wird nun klarer, warum ich denke, dass theaterpädagogische Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung so gut zusammen passen. Und vielleicht hast du auch schon eine Idee, was genau ich gerne einsetze und warum.
Ich nutze gerne Rollenarbeit um meinen Coachees dabei zu helfen, sich selbst in ihren verschiedenen sozialen Kontexten zu verorten und Entwicklungsaufgaben zu identifizieren. Übungen aus dem Improtheater setze ich gerne im Coaching und in Trainings ein. Im oben beschriebenen sicheren Rahmen und ggf. im Schutz der Rolle können spielerisch neue Strategien oder Verhaltensweisen erkundet, entwickelt oder erprobt werden. Neue Kommunikationstechniken können trainiert und Spontaneität, Kreativität und Teamgeist gefördert werden. Ein absoluter Favorit ist das Statuskonzept, das ebenfalls aus dem Improtheater stammt. Es nützt nicht nur zur Analyse von sozialen Rollen, sondern ist darüber hinaus auch zum Verstehen und Verbessern von Kommunikation, Konflikten und Beziehungen dienlich. Meine Lehramtsstudierenden kennen es inzwischen alle.
Theater dient in meiner Arbeit als Coach und Trainer wie du siehst nicht nur als bloße Metapher oder Analogie. Ich nutze ganz gezielt ausgewählte Methoden und Konzepte und bringe mit Übungen und Spielen meine Teilnehmenden kreativ in Aktion. Wenn du neugierig geworden bist oder Fragen hast, melde dich gerne.
Dein Sebastian