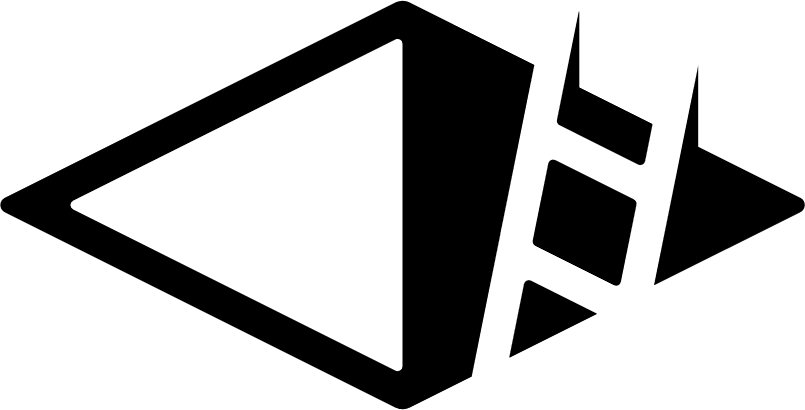„Solange es Haare gibt, liegen sich Menschen in denselben“, sagte Heinz Ehrhardt. Zumindest über den Wahrheitsgehalt dieser Aussage müssen wir wohl nicht streiten. Und er ist ja auch für etwas gut, der Streit. Wobei wir ihn dann lieber „Diskussion“ nennen. Auch wenn das im Kern vielleicht doch noch einmal etwas anderes ist. Ein Streit ist immer emotional. Diskussionen kann man zumindest auch sachlich führen. Beim Streit sind jedoch die Gemüter erhitzt. Wir ärgern uns, sind wütend, vielleicht sogar aggressiv. Auf jeden Fall ein unangenehmes Gefühl. Gut, wenn man sich wieder vertragen kann. Dann kann Streit sogar etwas Reinigendes oder Nähe-Schaffendes haben. Reibung erzeugt bekanntlich ja auch Wärme. Schlecht jedoch, wenn das nicht gelingt und aus dem immer wiederkehrenden Streit mit der Zeit ein regelrechter Konflikt erwächst. Das hilft niemandem.
Aber wie geht das eigentlich, „gesund streiten“? Wie lernt man, im Streit einen kühlen Kopf zu bewahren? Und was braucht es, um sich zu vertragen? Eine Pauschallösung gibt es meines Erachtens nicht. Es hängt viel davon ab, was du beim Streiten über dich und den Anderen denkst oder glaubst. Darum möchte ich dir im Folgenden fünf Denkanstöße mitgeben, die dir dabei helfen können, besser mit Streit umzugehen.
Im Streit tendieren wir dazu, den Grund für unsere Wut, unseren Ärger, unseren Frust etc. im Anderen zu verorten: „Du machst mich wütend!“ Wenn ich das so sage, passieren zwei Dinge, die einem positiven Ende des Streits entgegenstehen. Erstens weise ich meinem Streitpartner eine Schuld zu, was ihn mit großer Wahrscheinlichkeit emotional trifft und darum in den Widerstand schickt. Ich lade den Streit also weiter auf. Zweitens gebe ich meine Selbstverantwortung ab. Indem ich mein Wohlbefinden vom Verhalten des Anderen abhängig mache, verliere ich ein Stück Autonomie und bürde dem Anderen Verantwortung für mich auf. Das macht den Streit dann doppelt so anstrengend, weil man ja eigentlich gerade dabei ist, sich voneinander abzugrenzen.
Ich kann aber auch anders an die Sache herangehen. Statt dem Gegenüber die Schuld für mein Gefühl in die Schuhe zu schieben, kann ich die Perspektive einnehmen, dass sein Verhalten nur der Auslöser ist, nicht aber der Grund. Der eigentliche Grund für meine Wut, meinen Ärger etc. ist vielmehr der Umstand, dass ich ein Bedürfnis habe, das gerade nicht erfüllt wird. Und darum bin ich wütend oder verärgert etc.
Wenn ich das nun auch so sage, also „Ich bin wütend“, statt „Du machst mich wütend“, dann hat das mindestens zwei Vorteile. Erstens vermeide ich Schuldzuweisungen und lade den Konflikt nicht zusätzlich aktiv auf. Zweitens fokussiere ich die Aufmerksamkeit auf mich und lade den Anderen dazu ein, sich empathisch auf mich einzulassen. Dann kann ich dazu übergehen, mein Gefühl zu begründen, indem ich meine Bedürfnisse mitteile. Wenn mein Gegenüber mich auf dieser Ebene versteht, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass wir innerhalb der Situation zu einem Einverständnis kommen und uns vertragen können.
Es gibt sogenannte „Pseudogefühle“, die zu äußern nicht hilfreich ist. Das sind in der Regel Resultate einer Bewertung, wie z.B. „Ich fühle mich ausgegrenzt“. Solche Formulierungen drücken eher aus, wie man über eine Situation denkt und sie unterstellen dem Gegenüber wieder eine Täterschaft. Damit sind wir erneut bei der Schuldzuweisung etc. Daher ein Tipp: Wenn ich mein Gefühl nicht durch „Ich bin…“ ausdrücken kann, sondern „Ich fühle mich…“ oder „Ich habe das Gefühl, dass…“ sagen müsste, dann kann es gut sein, dass ein Pseudogefühl vorliegt und ich nochmal etwas tiefer graben muss, um mein eigentliches Gefühl zu erkennen.
Was für mich gilt, gilt natürlich auch für den Anderen. Mein Streitpartner wird ebenso wie ich Gefühle haben, die daraus resultieren, dass Bedürfnisse auf seiner Seite nicht erfüllt sind. Ich muss daher die Perspektive des Anderen ebenso in den Blick nehmen wie meine, wenn ich mich mit ihm vertragen möchte. Ich darf jedoch nicht davon ausgehen, dass er denkt wie ich und er seine Gefühle und Bedürfnisse so differenziert benennen kann. Aber ich kann ihn dazu einladen.
Das beste Mittel dafür sind m.E. gute Fragen. Wenn ich z.B. nicht weiß, warum mein Gegenüber gerade sauer auf mich ist, kann ich fragen: „Was genau habe ich getan, das bei dir so eine Wut ausgelöst hat?“ oder „Was an der Situation hat dich so gekränkt?“. Dadurch bestätige ich sein Gefühl (ohne eine Schuld meinerseits einzuräumen), anstatt es abzuwehren und ihn weiter in den Widerstand zu schicken.
Seine Bedürfnisse direkt zu erfragen, wird in den meisten Situationen nicht funktionieren. Dazu fehlt im Streit i.d.R. die Reflexionsfähigkeit. Wenn ich dennoch erfahren möchte, welche Bedürfnisse beim Anderen nicht erfüllt sind, kann ich aber „über Bande“ spielen. Ich kann bspw. fragen: „Welche Reaktion hättest du dir von mir gewünscht?“, „Wie wäre die Situation deiner Meinung nach besser gelaufen?“ oder „Was brauchst du jetzt gerade, um dich besser zu fühlen?“. Aus den Reaktionen kann ich auf seine Bedürfnisse schließen und mich ggf. durch Fragen rückversichern: „Bräuchtest du also…?“ oder „Geht es dir im Grunde also um…?“.
Zum Auflösen des Streits müssen wir beide einander verstehen. Wenn wir die Bedürfnisse des jeweils Anderen kennen, können wir nach Wegen suchen beider Bedürfnisse zu erfüllen.
Diese ersten beiden Denkanstöße stammen aus der Gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg. Die Technik an sich mag manchmal wirken, als würde man mit Kanonen auf Spatzen schießen, aber die Haltung, die darunter liegt, ist bei jedem noch so kleinen Streit extrem hilfreich!
Das Ergründen der Bedürfnisse ist noch auf einer weiteren Ebene im Streit hilfreich. Nämlich dann, wenn es darum geht, Fehlverhalten oder verletzende Handlungen anzusprechen.
Im Kern geht es um folgenden Gedanken: Jedem Verhalten liegt ein annehmbares Bedürfnis zu Grunde. Bedürfnisse hat jeder Mensch. „Echte Bedürfnisse“ sind dabei solche, die quasi universell von jedem Menschen bejaht werden können. Dazu gehören die lebensnotwendigen Grundbedürfnisse wie z.B. Essen, Schlafen und Sicherheit von Leib und Leben, aber auch abstraktere wie die Bedürfnisse nach Wertschätzung, Zugehörigkeit, Autonomie, Freiheit, Kontrolle etc. Nicht jeder Mensch empfindet jedes Bedürfnis gleich stark, aber sie sind zumindest für jeden nachvollziehbar bzw. annehmbar und für sich genommen weder gut noch schlecht. Sie sind einfach menschlich.
Damit müssen wir sie allerdings abgrenzen von Wünschen, welche zwar auch auf Bedürfnissen beruhen, die aber schon Erfüllungsstrategien mitdenken. Z.B. kann der Wunsch nach einer Beförderung auf den Bedürfnissen nach Kontrolle, Anerkennung, finanzieller Absicherung etc. beruhen. Aber nicht jeder, der diese Bedürfnisse hat, will auch eine Führungsposition einnehmen.
Um unsere Bedürfnisse zu erfüllen, müssen wir etwas tun. Wir müssen handeln bzw. uns in irgendeiner Art und Weise verhalten. Und da sitzt das Konfliktpotential. Denn wenn ein Verhalten dafür sorgt, dass die Bedürfnisse Anderer nicht erfüllt werden können, Werte Anderer verletzt werden oder es sonstige negative Auswirkungen hat, z.B. auf die Umwelt, die Gesellschaft o.Ä., dann ist dieses Verhalten problematisch. Nicht jedoch die zu Grunde liegenden Bedürfnisse.
Wenn es mir im Streit gelingt, zwischen den Bedürfnissen und dem Verhalten zu unterscheiden, ergeben sich neue Ansatzpunkte zur Streitlösung. Auch wenn ich das Verhalten verurteile, kann ich doch die Bedürfnisse wertschätzen. Und wenn ich die Bedürfnisse kenne, dann kann ich nach neuen, kompatiblen Verhaltensweisen suchen, um sie zu erfüllen.
Wer hat eigentlich mit dem Streit angefangen? Nicht immer gibt es darauf eine eindeutige Antwort. Oft geht der verbalen Auseinandersetzung nämlich eine ganze Reihe von Interaktionen voraus, die sich jetzt im Streit entladen. Auf die Frage, wer angefangen hat, erwidern dann oft beide Seiten, dass sie doch nur auf die Aktionen der anderen Seite reagieren. „Ich hab das doch nur gesagt/gemacht, weil er/sie…“
Wir denken den Streit wie eine Kausalkette von Aktion und Reaktion. Auf A folgt B. Dummerweise ist die Perspektive des Anderen aber: Auf B folgt A. Und aus der jeweiligen Perspektive ist das meistens auch gut nachvollziehbar. Watzlawick hat das umschrieben mit den Worten „Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung zugleich.“ Wir haben es nicht mit Ketten von Aktion und Reaktion zu tun, sondern mit Teufelskreisen, die sich immer weiter drehen.
Die Frage danach, wer angefangen hat, ist daher häufig gar nicht so zielführend, wie man vielleicht meint. Viel wichtiger ist die Frage danach, was man tun kann, um den Teufelskreis zu durchbrechen. Dabei können die oben beschriebenen Strategien zum Fokus auf Bedürfnisse, Perspektivwechsel und Wertschätzung helfen.
Aus dem Fokus auf die Bedürfnisse als Kern eines Streits folgt ein weiterer Gedanke, der als VW-Technik u.a. auch im Coaching eine Rolle spielt: Hinter jedem Vorwurf steckt ein Wunsch. Wie ist das gemeint?
Denken wir das Ganze einmal durch: Ich habe ein Bedürfnis. Um dieses Bedürfnis zu erfüllen, schweben mir bestimmte Dinge vor. Z.B. eine bestimmte Strategie, ein Verhalten, ein oder mehrere Orte, Termine oder eine Zeitspanne, eine oder mehrere Personen etc. Daraus ergibt sich ein mehr oder weniger konkreter Wunsch, der bspw. folgende Struktur haben kann: Ich wünsche mir, dass mein Bedürfnis XY dann und dort mit diesen Personen auf diese und jene Weise erfüllt wird. Jetzt führen die Umstände oder das Verhalten anderer Menschen dazu, dass dieser Wunsch so nicht in Erfüllung geht. Ein Teil oder alle Teile werden nicht so wahr wie erhofft. Das löst dann bei mir Ärger aus. Wenn ich die Schuld an dem Ärger nun der Person zuschreibe, die ich auf Grund ihres Verhaltens für die Nicht-Erfüllung verantwortlich mache, dann äußere ich das als Vorwurf: „Deinetwegen…“, „Weil du…“, „Du hast… und darum…“.
Statt des Vorwurfs könnte ich aber auch einfach meinen Wunsch äußern. Damit mache ich meine Perspektive, meine Erwartungshaltung und meine angestrebte Strategie klar. Dann kann sich der Gegenüber dazu verhalten und ein konstruktives Gespräch bleibt deutlich wahrscheinlicher, da kein Angriff erfolgt ist.
Im Streit geht es im Grunde immer um konkurrierende Bedürfnisse. Weil sie unerfüllt bleiben, reagieren wir emotional und es kommt zur Auseinandersetzung. Um den Streit zu schlichten und sich wieder zu vertragen, müssen die Bedürfnisse beider Seiten wertgeschätzt werden. Ich hoffe, dass die Denkanstöße, die ich hier präsentiert habe, dir dabei helfen, diese Bedürfnisse zu erkennen, sie zu kommunizieren, die emotionale Betroffenheit und das Hochkochen im Streit zu reduzieren sowie konstruktiv und wertschätzend nach Lösungen zu suchen, um sich wieder zu vertragen.
Wenn du mehr zum Thema Konfliktbewältigung erfahren möchtest oder Unterstützung brauchst, melde dich gerne bei mir. Auch über Rückmeldungen zu deinen Erfahrungen mit diesen Denkanstößen freue ich mich.
Dein Sebastian