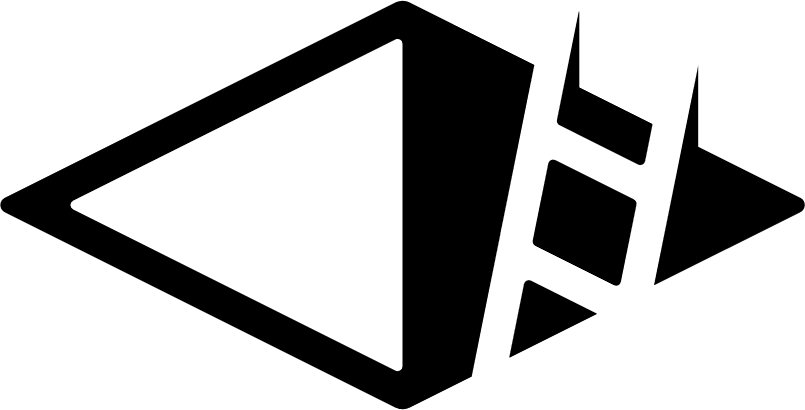Das Schönste an meiner Arbeit – sei es als Lehrkraft oder als Coach – ist es zu erleben, wie Menschen wachsen und sich entwickeln. Für mache bedeutet das z.B. „zu sich zu finden“, „für sich einzustehen“ oder „über sich hinauszuwachsen“. Ganz häufig sind aber zwei Dinge im Fokus: Selbstständigkeit erlangen und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten entwickeln. Es geht also im weitesten Sinne um Autonomie und Selbstwirksamkeit. Diese beiden Begriffe sind natürlich auf eine gewisse Weise „Container“. Es gibt zwar wissenschaftliche Definitionen, aber im alltäglichen Sprachgebrauch ist mitunter nicht klar, was genau gemeint ist. Darum möchte ich dir im Folgenden beschreiben, warum mir diese beiden Begriffe so wichtig sind und was sie für meine Arbeit bedeuten.
Der Duden umreißt den Begriff Autonomie mit den Worten „Unabhängigkeit, Selbstständigkeit und Willensfreiheit“. Das erklärt einen Containerbegriff aber auch nur mit drei anderen. Für meine Arbeit nutze ich daher gerne den Autonomiebegriff aus der Transaktionsanalyse nach Eric Berne. Demnach ist Autonomie ein Konstrukt, das sich in drei Aspekte gliedert: Bewusstheit, Spontaneität und Intimität.
Mit Bewusstheit ist die Fähigkeit gemeint, wahrzunehmen was ist, ohne zu bewerten. Das umfasst die sinnliche Wahrnehmung unserer Umwelt (sehen, hören, riechen, schmecken, tasten) ebenso wie die innere Wahrnehmung von Gefühlen, Gedanken oder Bewegung. Im Grunde könnte man diese Art der Bewusstheit auch Achtsamkeit nennen. Achtsamkeit ist gerade sehr „in“. Und das aus gutem Grund! Achtsamkeitsübungen sind beispielsweise Teil von Meditation, Yoga, Entspannungsübungen, Feldenkrais-Arbeit und vielem mehr. Sie helfen beim Umgang mit Stress, Überforderung und Erschöpfung und stärken die Resilienz und Klarheit im „Hier und Jetzt“.
Für mich und meine Arbeit bedeutet Bewusstheit auch, immer wieder wahrzunehmen, was ist und es konstruktiv zu nutzen. Das ermöglicht, aus einer lähmenden Problemfokussierung heraustreten zu können um sich möglichen Lösungen zuzuwenden. Du kennst vielleicht das Gefühl, im eigenen Gedankenkarussell festzustecken, von der emotionalen Last mitgerissen zu werden und immer tiefer in das Leid einzutauchen, das dein Problem auslöst. Das kann sich bis zur Verzweiflung steigern. Bewusstheit oder Achtsamkeit zu praktizieren impliziert jetzt nicht, das Leid zu ignorieren. Es bedeutet viel mehr, das Leid wahrzunehmen, ohne ihm emotional zu folgen.
Mit verschiedenen Techniken lässt sich eine schützende Distanz zum Leid herstellen, die es uns erlaubt, mit dem Leid bzw. den Leid auslösenden Problemen zu arbeiten, ohne dass uns das Leiden an sich hemmt oder blockiert. Gleiches gilt für auch für andere Emotionen wie Wut, Angst, Aufregung, Überforderung usw. Manchmal können auch positiv erlebte Emotionen so überwältigend sein, dass ein autonomes Handeln schwierig wird. Auch da kann die Bewusstheit helfen, klar und selbstbestimmt zu bleiben.
Spontaneität ist bei Berne definiert als „Flexibilität im Denken, Fühlen und Handeln“. Dies beschreibt im Grunde eines der wesentlichsten Ziele im Coaching-Prozess. Um das genauer zu erklären, möchte ich ein bisschen ausholen.
Wenn wir leiden oder unter Druck stehen, dann fühlen wir uns meistens so, als würden wir nur noch reagieren und Notwendigkeiten folgen. Vielleicht kennst du auch das Gefühl fremdbestimmt zu sein, keine andere Wahl zu haben oder einer Situation ausgeliefert zu sein. In solchen Momenten spielen sich bei uns bestimmte Muster in unseren Gedanken und Verhaltensweisen ab. Diese Muster haben wir im Laufe unseres Lebens erlernt. Immer, wenn die Umstände entsprechend sind, laufen sie ab, wie ein Programm, das gestartet wird. Wie sehen keine Alternativen.
Wenn wir es aber schaffen, in solchen Momenten achtsam zu sein und die oben beschriebene Bewusstheit an den Tag zu legen, dann kann es gelingen, andere Optionen zu sehen oder zu entwickeln. Wir müssen nicht in ähnlichen Situationen immer das Gleiche denken, fühlen oder tun. Im Coaching geht es häufig darum, genau diese Spielräume zu erweitern, Möglichkeiten zu sehen und selbst zu entscheiden, statt sich der Situation zu fügen. So ein Zugewinn an Spontaneität und Flexibilität kann enorm befreiend sein.
Mit Intimität meint Berne die Fähigkeit, Beziehung bewusst (!) und situativ angemessen zu gestalten. Das umfasst u.a. die Themen Nähe/Distanz, Offenheit, emotionale Anknüpfung u.v.m. Damit ist es eine Grundkompetenz in der Kommunikation. Wenn ich positiv und konstruktiv mit einem Menschen in Kontakt treten möchte, muss ich zunächst für eine positive und angemessene Beziehung sorgen. Dazu gehört bspw. eine wertschätzende Grundhaltung, Empathie und Zuwendung sowohl gegenüber dem Anderen als auch mir selbst gegenüber. Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse und Werte offen mitteilen, ohne anzugreifen oder übergriffig zu sein. Raum zugestehen, Anderen wie sich selbst. Konflikte konstruktiv managen, sich selbst authentisch und kongruent verhalten etc. Die Liste ist lang, der Kern aber ist immer der gleiche.
Im Coaching ist Beziehung essentiell. Aber auch in meiner Tätigkeit als Kommunikationstrainer nimmt sie eine zentrale Rolle ein. Denn wenn ich „gut“ kommunizieren möchte, muss ich bewusst Beziehung gestalten. Auf diese Weise wird der Begriff der Intimität im Sinne von Beziehungsfähigkeit zum zentralen Bestandteil jedes Kommunikationstrainings.
Sicher kennst auch du das Phänomen, dass es je nach Art der Beziehung leichter oder schwerer fällt mit jemandem über bestimmte Themen zu sprechen. Oder dass man je nach Beziehung manchen Menschen eher Glauben schenkt oder eben nicht. Bei Watzlawick heißt es: „Jede Kommunikation hat eine Sach- und eine Beziehungsebene, wobei die Beziehungsebene die Sachebene bestimmt.“ Mit anderen Worten: Beziehung vor Inhalt. Nur wenn eine positive und konstruktive Beziehung besteht, kannst du positiv und konstruktiv auf der Sachebene kommunizieren.
Im Übrigen richtet sich die Fähigkeit zur Beziehungsgestaltung nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Beispielsweise, wenn wir mit dem inneren Team (nach Schulz von Thun) arbeiten. Auch zu unseren verschiedenen Persönlichkeitsanteilen brauchen wir eine positive Beziehung, sonst fahren sie uns immer wieder in die Parade und spielen ihre Programme ab. Solche nach innen gerichtete Beziehungsarbeit stärkt also auch die Spontaneität.
Bewusstheit, Spontaneität und Intimität bestärken einander. Es ist daher sinnvoll, sie nicht isoliert zu betrachten, sondern im Prozess immer wieder zu reflektieren und zu spüren, wie sie einander beeinflussen. Insgesamt ist m.E. einleuchtend, dass selbstbestimmtes Handeln ein gesundes Maß an Bewusstheit, Spontaneität und Intimität voraussetzt. Nur wenn ich eine Situation bewusst im Hier und Jetzt wahrnehme ohne zu werten, kann ich mich von emotionalen Triggern lösen. So vermeide ich, in Muster zu verfallen. Nur wenn ich flexibel im Denken, Fühlen und Handeln bin, kann ich meine Spielräume erweitern und neue Strategien finden. So kann ich alternative Wege gehen um meine Bedürfnisse, Werte und Wünsche zu leben. Nur wenn ich bewusst Beziehung gestalte, kann ich Konflikte nach außen sowie nach innen konstruktiv managen und neue Strategien umsetzen. Die so gewonnene Unabhängigkeit, sei es von Situationen, anderen Menschen oder meinen eigenen Mustern, stärkt wiederum meine Fähigkeit zur Bewusstheit. Ein heilsamer Prozess.
Der Begriff Selbstwirksamkeit geht auf den Psychologen Albert Bandura zurück. Er beschreibt das „Vertrauen in die eigene Tüchtigkeit“ [1]. Mit anderen Worten: Du hast ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit bzw. eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung, wenn du darauf vertraust, dass du auch schwierige Situationen und Herausforderungen dank deiner Kompetenzen und aus eigener Kraft heraus erfolgreich bewältigen kannst.
Selbstwirksamkeitserleben erhöht das Selbstvertrauen und den wahrgenommenen Selbstwert. Damit spielt das Konzept im Coaching eine zentrale Rolle. Beispielsweise wenn es darum geht, die eigene Leistungsfähigkeit zu erhöhen, mit Stress und Belastung umzugehen oder ungeliebte oder gar schädliche Glaubenssätze und Verhaltensmuster zu bearbeiten.
Auch in Lernprozessen spielt die Selbstwirksamkeit einen wichtigen Part. Erfolgserlebnisse stärken die Selbstwirksamkeit. Damit steigt die Zuversicht, erfolgreich lernen zu können und damit auch die Motivation zum Lernen. Unterricht, der so angelegt ist, dass möglichst viele Erfolgserlebnisse möglich und wahrscheinlich sind, ist daher besonders lernwirksam.
Darüber hinaus führt das Lernen am erfolgreichen Beispiel, also das Beobachten einer Vorbildperson, zur Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartung. Das bedeutet, wenn du willst, dass deine Lernenden erfolgreich und motiviert lernen, was du ihnen nahebringen möchtest, dann sei ihnen ein gutes Beispiel und mach es vor. Speziell im Kontext von Kommunikationstraining und im Beibringen von didaktischen und pädagogischen Konzepten und Werkzeugen gilt: Lebe, was du vermittelst. Das ist mein Credo für all meine Lehr-Lern-Kontexte.
Autonomie und Selbstwirksamkeit spielen für mich in meiner Arbeit eine große Rolle – sowohl im Bezug auf meine Coachees und meine Lernenden als auch im Bezug auf mein eigenes Handeln. Ich bin überzeugt, dass die hier umrissenen Konzepte und Mechanismen wesentlich für den Erfolg meines Handelns als Lehrkraft und Coach sind. Wenn du mehr darüber erfahren willst, deine eigene Autonomie und Selbstwirksamkeit stärken oder in deinen Lernenden entwickeln möchtest, dann schreib mir gerne. Ich freue mich auf den Austausch.
Dein Sebastian
[1] Diese Formulierung entstammt folgener Webseite: https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/selbstwirksamkeit/14009