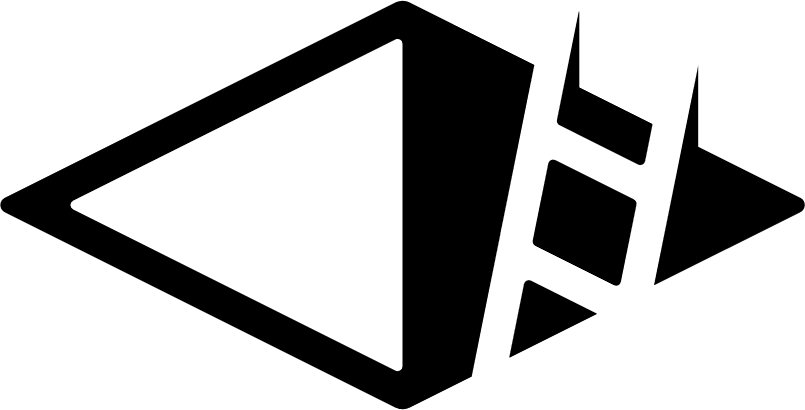„Wir können nicht nicht Kommunizieren“, sagt Watzlawick. Jedes Verhalten ist bereits Kommunikation und da wir uns nicht nicht verhalten können, sind wir praktisch ständig auf Sendung. Unsere Körpersprache kann eine ganze Menge über uns verraten. Z.B. wie wir uns fühlen, ob wir Kontakt suchen oder lieber in Ruhe gelassen werden, ob wir das Gegenüber mögen und vieles mehr. Je weniger wir auf unsere Körpersprache achten, desto ehrlicher ist sie. Aber wir nutzen sie auch um bewusst zu kommunizieren. Das kann bedeuten, sich besonders klar und ehrlich auszudrücken, aber auch, Gefühle zu überspielen oder Absichten zu verstecken. Doch je stärker eine Emotion ist, desto schwieriger ist es, sie nicht in Mimik, Gestik, Körperhaltung etc. durchscheinen zu lassen.
Unsere Gefühle beeinflussen unsere Körpersprache sehr stark. Das ist jedoch keine Einbahnstraße. Haltung, Bewegungsqualität, Mimik und Gestik können sich auch darauf auswirken, wie wir uns fühlen. Eine aufrechte Haltung, ein bewusstes Lächeln und ein schwungvoller Gang können bspw. tatsächlich die Laune heben. Hängende Schultern, ein gesenkter Blick und ein ausweichender, stolpernder Gang verschlechtern die Laune hingegen. Wer jetzt an den Satz „Fake it till you make it“ denkt, hat nicht unrecht, auch wenn das alleine noch nicht zum Ziel führt.
Besonders eindrücklich wird der Zusammenhang zwischen Körpersprache, Gefühl und Kommunikation bei den sogenannten Status-Gesten. Was das ist und warum sie so wertvoll für wirkungsvolle Kommunikation sind, möchte ich dir hier zeigen.
Das Status-Konzept spielt interessanter Weise auch im Theater eine große Rolle (Wobei dich das bei mir vielleicht auch nicht mehr wundert ;P). Mir ist es zum ersten Mal im Improvisationstheater begegnet, wo das Konzept vor allem mit Keith Johnstone in Zusammenhang gebracht wird. Er unterscheidet Hochstatus und Tiefstatus, die sich nach außen durch verschiede körpersprachliche Zeichen äußern.
Hochstatus wird nach außen bspw. sichtbar durch
Tiefstatus zeigt sich nach außen bspw. durch Zeichen wie
Diese Gesten führen wir, wenn wir nicht explizit darauf achten, relativ unbewusst bzw. affektiv aus. Jeder Mensch hat dabei ein individuelles Gestenrepertoire, das er sich im Laufe seines Lebens angeeignet hat.
Welche Geste sich in einer Situation zeigt, hängt davon ab, was man intendiert. Habe ich in der Situation die Absicht zu dominieren (anleiten, anführen, kontrollieren, besiegen, beschützen, verteidigen etc.), dann werde ich Hochstatus-Gesten nutzen. Will ich kooperieren oder mich unterordnen (mitmachen, folgen, abgeben, sich führen lassen, nachgeben etc.), so werde ich Tiefstatus-Gesten nutzen.
Darüber hinaus gibt es auch Status-Ggesten und Status-Zeichen, die nicht direkt körpersprachlicher Natur sind, aber dennoch zur nonverbalen Kommunikation zählen. Dazu gehören beispielweise die Wahl der Kleidung, die Distanz zu anderen Menschen, Leute beim Namen nennen oder nicht, Körperhygiene, Accessoires u.v.m.
Wie meine Status-Gesten wahrgenommen werden, hängt von mehreren Faktoren ab. Ob eine Status-Geste oder ein Status-Zeichen angemessen wirkt, ist vom Kontext abhängig. So ist bspw. das Tragen einer Jogginghose im Sportunterricht passend, bei einer Beerdigung hingegen nicht. Ob eine Geste als angenehm und sympathisch oder unangenehm und unsympathisch wahrgenommen wird, hängt wiederum stark davon ab, wie ich mich in der jeweiligen Situation fühle bzw. welches Selbstbild ich habe.
Ist mein Selbstbild in Bezug auf die Situation eher negativ und gehe ich mit negativen Gefühlen hinein, so werden meine Hochstatus-Gesten i.d.R. eher arrogant, aggressiv oder abweisend aufgenommen werden. Dann sorge ich für Distanz. Habe ich ein positives Selbstbild bzw. fühle ich mich in Bezug auf die Situation wohl, bspw. weil ich mich kompetent, sicher, kraftvoll etc. fühle, dann werden meine Hochstatus-Gesten eher dazu führen, dass mir Autorität und Respekt zugesprochen werden. Jedoch bewirken Hochstatus-Gesten eher Distanz als Nähe.
Auch in Bezug auf die Tiefstatus-Gesten haben unterschiedliche innere Zustände einen Einfluss auf ihr Wirkung. Bei einem eher negativen Selbstbild oder negativen Gefühlen in einer Situation werden meine Tiefstatus-Gesten eher für Mitleid und Bedauern sorgen oder bewirken, dass man mich eher ignoriert. Ein positives Selbstbild bzw. positive Gefühle hingegen können bewirken, dass meine Tiefstatus-Gesten dazu beitragen, Nähe, Sympathie und Vertrauen herzustellen.
Den Wert der Kenntnis von Status-Zeichen ist für dich an dieser Stelle vielleicht schon spürbar. Doch warum die Status-Gesten so ein mächtiges Instrument in der nonverbalen Kommunikation sind, wird erst richtig deutlich, wenn wir uns anschauen, welche Wirkung sie in der Interaktion auf das Verhalten unserer Mitmenschen haben.
Status-Gesten sind im Grunde allgegenwärtig, da sie ein Aspekt von Beziehung sind. Bei Watzlawick oder Schulz von Thun finden wir die Aussage, dass jede Kommunikation auch eine Beziehungsebene hat. Und da jedes Verhalten bereits Kommunikation ist (auch Watzlawick), verrät auch jedes Verhalten etwas über die Beziehung der sich verhaltenden Person zu den Menschen um sie herum bzw. zur Situation. Das nehmen wir meistens gar nicht bewusst wahr. I.d.R. reagieren wir intuitiv, affektiv oder unterbewusst auf die Status-Gesten unserer Mitmenschen.
Besonders deutlich wird das bspw. beim Gang durch die volle Fußgängerzone. Hier möchte ich dich zu einem kleinen Experiment einladen. Wenn du das nächste Mal durch die Stadt läufst, tue folgendes: Nimm einmal ganz bewusst einen Hochstatus in deinem Verhalten ein. D.h. du hältst dich aufrecht mit geradem Kopf und bewegst dich zielstrebig und gerade auf dein Ziel zu. Den Menschen in deinem Weg schaust du freundlich aber bestimmt in die Augen und hältst eine entspannte Geschwindigkeit. Bewege dich so durch die Menschenmenge und beobachte, wie die anderen um dich her reagieren. Tue dann das Gleiche im Tiefstatus. Das bedeutet z.B. leicht eingefallene Haltung, gesenkter Kopf, den Blicken ausweichend, Hände in den Taschen und darauf bedacht, niemanden zu stören.
Ich prophezeie dir, dass dir im ersten Fall die Menschen ausweichen werden und du relativ ungehindert vorangehen können wirst, während du im zweiten Fall ständig ausweichen und praktisch wie im Slalom zwischen allen anderen hindurch huschen und drängen wirst. Vermutlich wirst du dich in der ersten Variante etwas wohler und sicherer fühlen, wenn auch vielleicht etwas arrogant (je nachdem, wie freundlich du dabei bist). Im zweiten Fall fühlst du dich vermutlich unwohler, gestresster und gehetzter. Und je länger du einen Status hältst, desto stärker wird das Gefühl.
Was du dabei erlebst, ist die sogenannte Status-Wippe. Spielst du Hochstatus, werden die anderen Menschen, die dir begegnen, eher mit ihrem Status runter gehen (hier ausweichen). Das wird vielleicht sogar mit der Zeit deinen Status noch mehr heben und du wirst dich immer sicherer fühlen. Spielst du Tiefstatus, werden die anderen mit ihrem Status eher nach oben gehen (hier nicht ausweichen, sondern erwarten, dass du ausweichst). Das wird dich möglicherweise sogar weiter im Status senken und dein Unwohlsein verstärken.
Wenn wir noch einmal differenzierter auf die Wirkung der Statuswippe schauen, dann zeigt sich, dass der Satz „Ich geh runter, du gehst hoch auf der Status-Wippe“ nur eine erste Näherung ist. Denn welches Verhalten das Gegenüber zeigt (Hoch- oder Tiefstatusverhalten), hängt stark vom jeweiligen Gefühl bzw. Selbstbild des Gegenübers ab.
Wenn mein Gegenüber bspw. in einer Situation verunsichert ist und hofft, dass es Hilfe bekommt, wird mein Hochstatusspiel dafür sorgen, dass es entsprechend im Tiefstatus reagiert. Ist mein Gegenüber zwar unsicher, will aber vielleicht, dass ich das nicht merke, wird es auf mein Hochstatusspiel vermutlich selbst mit Hochstatus reagieren. Ein Streit, quasi ein Stausgerangel, könnte entstehen.
Das liegt daran, dass mein äußeres Statusspiel erst mal auf den inneren Zustand meines Gegenübers, also dessen inneren Status, wirkt. Welches Statusverhalten es dann nach außen zeigt, hängt von seinen Bedürfnissen, Zielen und Absichten, seinem Selbstbild, seiner Wahrnehmung in dem Moment und seinen Annahmen über sich, mich und die Situation ab.
Du siehst, das Status-Konzept erlaubt es, Kommunikations-Dynamiken und Beziehung auf der Basis der Wechselwirkung zwischen Verhalten und Gefühl zu verstehen und zu beeinflussen. Halten wir also fest:
Du weißt nun schon viel darüber, wie die Status-Gesten in der Kommunikation wirksam werden und warum sie ein machtvolles Werkzeug für ein gelingendes und positives Miteinander sein können. Wie du sie nun richtig einsetzen kannst und was es dabei zu beachten gibt, möchte ich dir in Teil 2 näher bringen.
Wenn du Interesse an diesem Thema hast, melde dich gerne bei mir.
Dein Sebastian